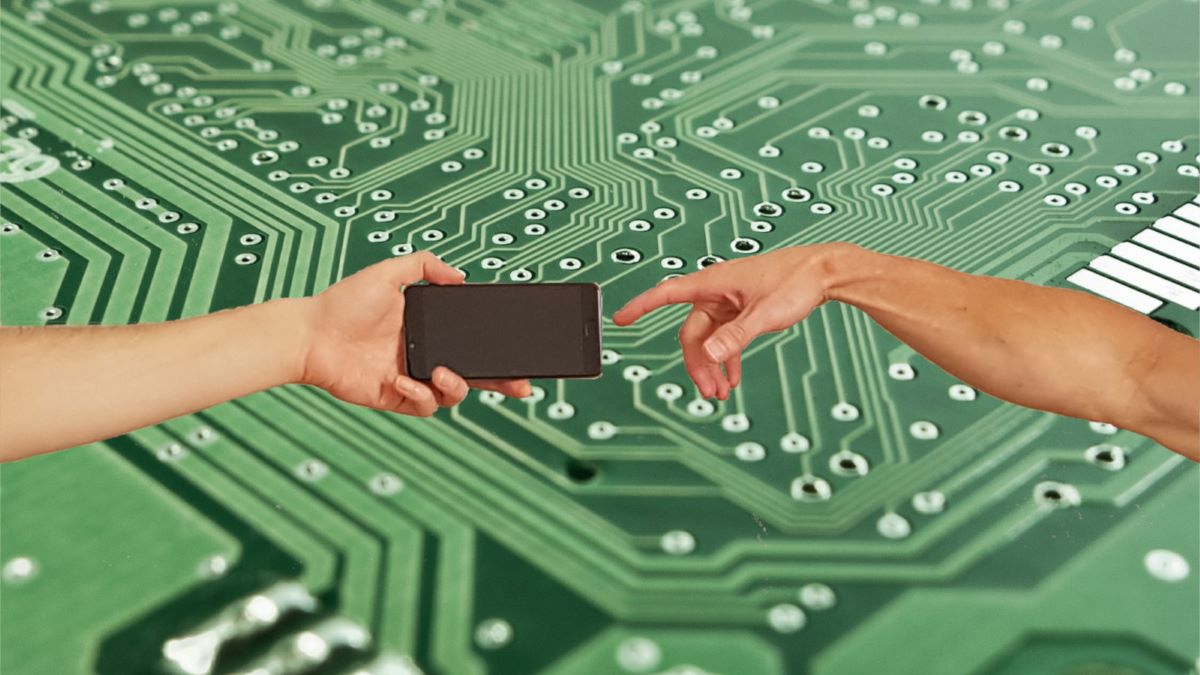Ein nahezu endloses Angebot an Apps, Webseiten, Therapieangeboten, Programmen und was sonst noch allem steht online zur Verfügung. Da stößt man dann auf Namen wie Online-Psychotherapie, E-Mental-Health-Programm, Cybertherapie, Selbstmanagement-Programm usw. Im Grunde genommen bezeichnen die verschiedenen Begrifflichkeiten alle ein ähnliches Prinzip, mit dem Ziel, durch internetgestützte Datenverarbeitung und Auswertung, meist zusammen mit dem Psychotherapeuten, der seelischen Heilung näher zu kommen.
Doch taugt es auch was? Was für einen Mehrwert, sprich, welchen Heilungserfolg hat diese moderne Technologie?
Die Geschichte der Online-Therapie reicht zurück bis zum Urvater der Psychoanalyse, nämlich keinen geringeren als Sigmund Freud selbst! Zwar gab es natürlich zu Freuds Zeiten kein Internet, dafür aber Briefe und ein Postsystem. Mit dem Beginn der Psychologie entstand auch die „Brief-Therapie“ – also eine analoge Form des E-Mail-Verkehrs quasi. Freud benutzte diese Kommunikationsart, um unter anderem gehaltvolle Psychoanalysen zu vermitteln, sein Beitrag zum Seelenheil seiner Patienten. Denn die zeitversetzte Kommunikation (E-Mail, SMS) hat sowohl für den Patienten als auch den Therapeuten den Vorteil, das Gedachte oder Gelesene sorgfältiger abzuwägen und sich somit genauer auszudrücken.
Nach Freud gab es immer wieder interessante Berührungspunkte zwischen der Psychotherapie und der Informatik. Einer dieser legendären Berührungspunkte war der deutschstämmige Amerikaner Josef Weizenbaum. Weizenbaum entwickelte 1966 seine „Eliza“. Eliza bildete einen Psychologen so glaubwürdig nach, dass die Patienten anhand des Dialoges nicht unterscheiden konnten, frei nach Alan Turing¹, ob es sich um einen Menschen oder eine Maschine handelte. Oder der redselige „Onkel Ezra“: Eine psychologische Algorithmenplaudertasche², die 20 Jahre interaktiv Menschen in Krisenzeiten beraten und begleitet hat. So gibt es also zahlreiche Beispiele, bei denen Prozessoren durch geschickte boolesche³ Datenauswertung (gespeist mit Multiple-Choice) teilweise täuschend echte Dialoge führen und gute Diagnosen stellen. Richtig Fahrt nahm die Entwicklung durch die Internetrevolution in den 90ern auf. Die Übertragungsgeschwindigkeiten wurden besser, der internetfähige Rechner verlor sein Nischendasein und zog in die Stuben und Arbeitsplätze. Flankiert durch die Mobilfunktechnologie entwickelte sich parallel ein Handy-App-Markt. Eine App (hergeleitet von Applikation) ist ein Anwendungsprogramm für das Handy. Der App-Markt bietet verschiedene Apps aus dem psychologischen Bereich. Angefangen von Life-Style-Apps über Informationsprogramme bis hin zu Stimmungstagebüchern. Die Idee, die hinter den Mood-Trackern (= Stimmungstagebüchern) steht, ist, dass man durch sorgfältig geführte Selbstbeobachtung Erkenntnisse gewinnt, die der Selbsttherapie oder der herkömmlichen dienlich sind. Wie bei den meisten digitalen Werkzeugen kann man die zuvor gespeicherten Daten alleine oder optimaler Weise mit dem Therapeuten auswerten.
Weitere Bestandteile der E-Psychotherapie lassen sich in zeitversetzte oder in „Echtzeit“⁴ geführte Kommunikation unterteilen. Videokonferenzen, Chat, Telefon gehören in die zweite Kategorie; wohingegen E-Mail, SMS der ersten zuzuordnen sind. Alle Komponenten lassen sich ortsunabhängig durchführen. Die Teilnehmer können so von jedem Ort der Welt miteinander in Verbindung treten, was sehr praktisch ist.
Laut DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) gibt es in Deutschland jedes Jahr ca. 18 Millionen (fast jeder dritte!) Erwachsene, die mit einer psychischen Störung zu kämpfen haben – von denen etwa nur jeder fünfte professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Auf Platz Eins liegen die Angststörungen, gefolgt von affektiven Störungen und Störungen durch Alkohol oder Medikamentenkonsum. Die, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, müssen oft lange auf Therapieplätze warten (siehe Monika Rosadas Bericht aus Ausgabe 11 des Zwielichts „Ein Sechser im Lotto? Oder eine Niete?“) und leiden zum Teil unter gesellschaftlicher Stigmatisierung.
Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass bei bestimmten Krankheiten die Online-Therapie positive Ergebnisse aufweist. Ein bevorzugtes und bewährtes Einsatzgebiet sind Depressionen, Soziale Phobien oder Panikstörungen. Gerade Menschen, die Kontaktschwierigkeiten haben und das Haus ungerne verlassen, können sich vom Schreibtisch aus ungehemmter äußern. Dagegenhalten kann man, frei nach Schopenhauers Stachelschweine-Parabel, dass der Mensch ein soziales Herdentier ist und die richtige Dosis menschlicher Nähe ein Grundbedürfnis ist. Allerdings gibt es Krankheitsbilder, die sich auch weniger gut für die E-Therapie eignen. Beispielsweise wird bei akuter Schizophrenie oder suizidalen Tendenzen eher davon abgeraten, da die notwendigen physischen Eingriffe nicht gegeben sind.
Quelle: Psychology at a Distance: Examining the Efficacy of Online Therapy: Ryan Baird Thompson (2016) https://pdxscholar.library.pdx.edu/honorstheses/285/
Wie im analogen Leben auch, gibt es, allgemein gesprochen, im Internet natürlich auch Qualitätsunterschiede. Um möglichst nicht minderwertigen Angeboten oder gar Scharlatanerie zu begegnen, wäre es empfehlenswert, dass der Therapeut ein approbierter, also staatlich zugelassener Psychotherapeut ist. Heilpraktiker für Psychotherapie sind nicht staatlich anerkannt und der Begriff ist anuch nicht geschützt. Das heißt: Jeder kann sich so nennen. Darüber hinaus verleiht der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen ein Gütesiegel für die psychologische Online-Beratung. Ziel dieses Gütezeichens ist es, eine Orientierung zum Auffinden qualitativ hochwertiger Beratungen zu geben.
Da die Online-Therapie ein relativ neues Feld ist, gibt es zum Thema Finanzierung innerhalb der Krankenkassen noch keine verbindlichen Standards. Erst bei einer zweiten (beharrlichen) Anfrage bei einer bekannten deutschen Krankenkasse erhielt ich die Information, dass, wenn der Therapeut einen Antrag stellt, die Krankenkasse potenziell bereit wäre, die Kosten zu übernehmen. Bei der ersten Kontaktaufnahme wusste eine Sachbearbeiterin nichts von der Möglichkeit einer Online-Therapie. Das Feld scheint auch für die Mitarbeiter recht neu zu sein.
Fazit:
Die Anzahl der verschiedenen Online-Therapien wächst im gleichen Maß wie der Bedarf nach Psychotherapie. Ob sie für einen selbst geeignet sind oder ob man einen vorteilhaften Nutzen daraus ziehen kann, lässt sich pauschal nicht beantworten. Hier wäre eine sinnvolle Abwägung nach verschiedenen Gesichtspunkten unter der Berücksichtigung der Krankheit sowie Erwartung im Hinblick auf die Heilung angebracht. Die hier beschriebenen technischen Instrumente sind lediglich als erweiternde Hilfsmittel zu sehen und nicht als Ersatz für einen Menschen. Nichtsdestotrotz sind diese unter bestimmten Umständen sinnvoll.