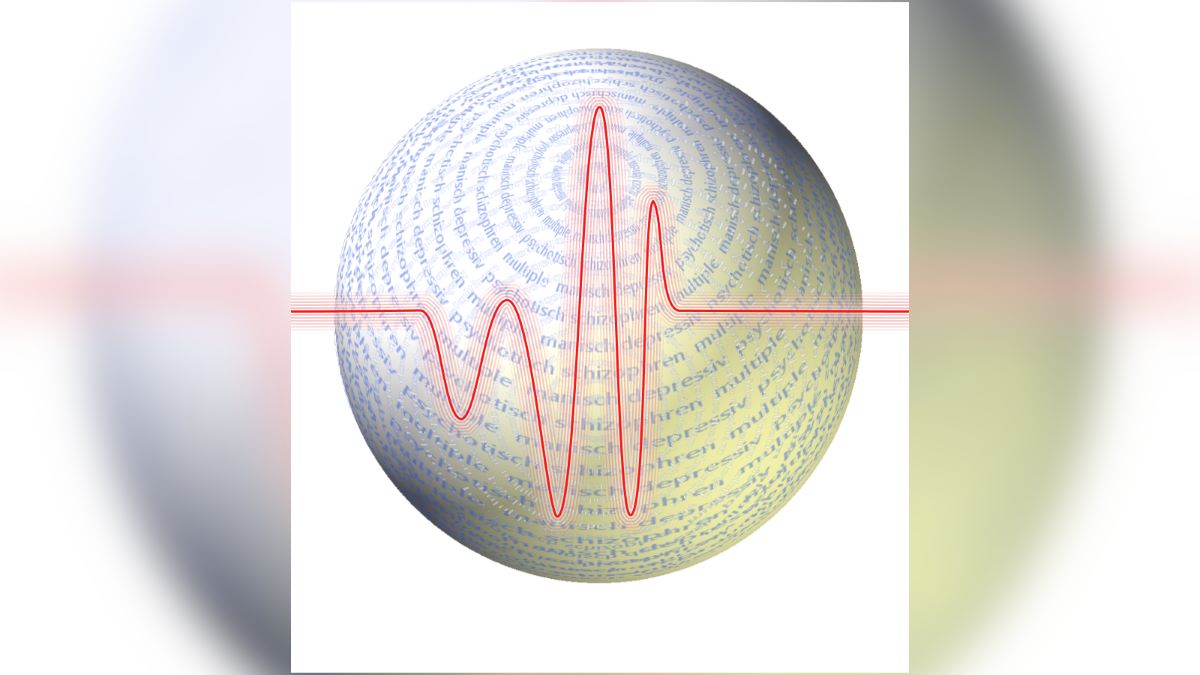Eine rote Stelle auf dem linken Unterarm, hm. Nach ein paar Tagen juckt sie und ich kratze zurück. Naja. Dann öffnet sich die Stelle und wässert. Spätestens jetzt ist ein Arztbesuch angesagt. Ob er eine Diagnose ausspricht oder nicht, der Arzt hat auf jeden Fall eine im Kopf, bevor er das Rezept für Salbe, Tinktur oder Tabletten ausfüllt. In diesem Bereich der Medizin scheinen Diagnosen unproblematisch, denn fast allen ist klar: Ohne Diagnose keine hilfreiche Therapie. Bei Aids gibt es weitgehend unbegründete Angst vor Ansteckung, das ist ein Grund, darüber nicht offen zu sprechen. Geschlechtskrankheiten sind noch peinlicher. Auch Krebs ist oft ein Unthema. Und psychische Erkrankungen? Auch dort geht eine ordentliche Diagnose einer hilfreichen Therapie voran, aber diese Notwendigkeit unterliegt so großen Widerständen von drei Seiten her, dass eine sachliche Sicht dabei öfters schwerfällt.
Erstens: In der Gesellschaft unterliegen psychische Erkrankungen einem Ih-gitt-Faktor, so was hat man doch nicht und das haben auch nur wenige andere, die man natürlich nicht kennt und mit Klapse und Seelenklempner möchte man nichts zu tun haben, Wer es selbst hat, spricht eher nicht darüber. Inzwischen ist das Land der Dichter und Denker so stark unter Druck, dass uns die Statistik etwas anderes ausweist als unser Selbst- und Fremdbild wahrhaben möchte: In Deutschland stehen jetzt unter allen jährlich statistisch erfassten Erkrankungen die psychischen Probleme an erster Stelle. Sowohl bei den behandelten Krankheiten überhaupt (stationär und ambulant), als auch bei den Krankmeldungen vom Arbeitsplatz (gelber Schein) und schließlich bei den Berentungen wegen Erwerbsminderung.
Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Wir können es uns nicht länger leisten wegzusehen. Der zivilisatorische Druck ist so hoch, dass unsere allgemein menschlichen Lebensbedingungen (= conditio humana) überfordert sind; der Anpassungsfähigkeit des Menschen an gesellschaftliche Zwänge sind Grenzen gesetzt. Wenn schon Mitmenschlichkeit nicht reicht, spätestens von den volkswirtschaftlichen Folgen müsste der homo oeconomicus ein Einsehen haben: Von zutreffenden Diagnosen her kann die Ätiologie (= Krankheitsentstehung) und eine mögliche Therapie (= Behandlung) angegangen werden. Tabuisierung hilft uns nicht.
Zweitens gibt es Widerstand von Klienten oder Patienten, die wegen der gesellschaftlichen Abwertung von psychischen Erkrankungen und den ent-sprechenden Diagnosen das Stigma und die Schamgefühle und die real zu befürchtende Ausgrenzung im Privat- und Berufsleben fürchten. Auch gehen der Widerwille gegen Diagnosen und gegen den Schwerbehindertenausweis oft Hand in Hand; man schützt seinen Stolz und schadet der Ent-wicklung. Doch ist Krankheitseinsicht die unverzichtbare und unvermeidbare Voraussetzung für einen Genesungsweg auch wenn sie insbesondere bei Psychosen stark erschwert ist. Ebenfalls haben Persönlichkeitsgestörte und Neurotiker mit innerem Widerstand zu tun. Gesunde verhalten sich übrigens nicht viel klüger. Wie viele Männer gehen nicht zur Krebsvorsorge, weil ihnen die penetrierende Untersuchungsmethode peinlich ist? Wie viele Frauen verlieren eine Brust, weil sie nicht rechtzeitig bei der Mammographie waren? Solange Angst und Schamgefühle gemieden werden, schließt man sich selbst von den Heilwegen aus. Wieviele Leute vermeiden die offene Austragung von Konflikten aus Angst oder Scham und bekommen dann körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Bandscheibenvorfall oder Magengeschwür? Unabhängig davon, was man von der Bibel hält, der Satz „Die Wahrheit wird Euch frei machen“ hat viel für sich. Abwehr jedenfalls verlängert das Leiden.
Eine dritte Art des Widerstandes gegen Diagnosen geht von den Helfern selber aus, die z. T. richtig beobachtet haben, dass Diagnosen als gesellschaftliche Ausgrenzer und damit als Herrschaftsinstrumente gegenüber abweichendem Verhalten missbraucht werden und deshalb gerne Diagnosen pauschal ablehnen. Das ist ein fatales Missverständnis beim Helfenwollen. Mit einem Skalpell kann man gut operieren oder auch morden, es kommt darauf an, dass man es sachgerecht konstruktiv einsetzt. Das sagt nicht etwas über das Skalpell aus, sondern über den, der es mit der Hand führt. Nach Paracelsus kann jede Arznei Medizin oder Gift sein, es kommt auf die Dosis an. Die Diagnose selbst ist nicht schuld an ihrem Mißbrauch, sondern sie muss verantwortungsvoll eingesetzt werden. Nicht wenige Anwender lehnen Diagnosen ab und haben doch heimlich ein diagnostisches Schema im Kopf: Insbesondere bei systemischen Therapeuten, Verhaltens-therapeuten und klassischen Analytikern findet sich ein häufiger Ansatz, Therapien für Neurotiker in ihrer Wirkweise zu verallgemeinern (z.B. „Gute Gedanken erzeugen gute Gefühle“) und sie auch auf früher gestörte Menschen anzuwenden. Da wundert es nicht, dass der Begriff der frühen Störung auch bei diesen Anwendern nicht auf Gegenliebe stößt. Und: Frühgestörte haben oft die Erfahrung gemacht, z.B. mit „neurotischer Depression“ oder „Anpassungsstörung“ fehl eingeschätzt zu werden und sind dadurch längere Therapiewege teils vergeblich gegangen, bis das eigentliche Störungsbild klarer zu Tage trat.
Psychodiagnostik unterliegt sowohl wissenschaftlichem Fortschritt als auch gesellschaftlichem Interesse. Wo mit Diagnosen z.B. pharmazeutisch Geld zu verdienen ist, wird Einfluß zu nehmen versucht auf die drei Diagnostiksysteme ICD, DSM und OPD1, aber so ist das überall. Es spricht nicht gegen gute Diagnostik selbst, sondern gegen das Verfahren, wie verbindliche diagnostische Codices zu stande kommen. Je mehr die Differentialdiagnostik sprachliche, körperliche oder sensomotorische Therapien indiziert, desto relativer wird der beherrschende Einfluß von Psychopharmaka. Wenn nun aber die Fortschreibung diagnostischer Systeme mit wissenschaftlicher Förderung der pharmazeutischen Wirtschaft direkt oder indirekt unterstützt würde, dann darf ein interessen-gelenktes Ergebnis zumindest nicht ausgeschlossen werden.
Ein weiterer Missstand ist, dass Klienten im akuten Zustand erstmal eine Diagnose bekommen, die später nicht verifiziert wird. Das könnte testdiagnostisch geschehen, ist aber wenig verbreitet. So laufen manche Leute noch Jahrzehnte lang mit falscher Diagnose herum, die nicht wirkenden Therapien (wegen falscher Diagnose) werden nicht in Frage gestellt und dann gilt der Klient irgendwann als therapieresistent und austherapiert, ein Drama. Dabei könnten Akutdiagnosen doch später gut nachgeprüft werden. Nichts gegen psychiatrische Erfahrung, aber Kontrolle ist besser: Die nicht in der Medizin, sondern in der Psychologie entwickelte Testdiagnostik erlaubt eine Überprüfung subjektiver Eindrücke der Behandler und trägt damit zum Schutz von Klienten bei.
Diagnosen sind wie Vergewaltigung, wenn sie falsch sind, zweckwidrig verwendet werden, stempelartig aufgesetzt und
jahrelang zugeschrieben, aber nicht überprüft werden, zum Ausschluss von echt helfenden Hilfen führen, uns auf ein Abstellgleis schieben und uns in die Hände inkompetenter Helfer führen.
Diagnosen können ein Segen sein, wenn sie
richtig sind, deshalb irgendwann akzeptiert werden können, sensibel vermittelt und
nachgeprüft und fortgeschrieben werden und
Grundlage für passende Therapie und andere Hilfen sind.
So ist es speziell mit der Psychodiagnostik auch. Die Crux ist also, dass der (krankheitsbedingte) Widerstand von Klienten gegen (ihre?) Diagnose Nahrung bekommt durch die Missstände, die es in der Psychodiagnostik objektiv gibt. Dass man sich selbst im Wege steht, ist also nicht allein ein Symptom psychisch Kranker, sondern der fachlichen Behandlungsseite ebenfalls, die nicht immer das bewirkt, was sie mit guter Diagnostik bewirken könnte.
Ist die Diagnose richtig, kann man sich daran abarbeiten. Sie benennt das Defizit oder den Konflikt, die entweder uns selbst das Leben schwer machen oder aus denen heraus wir – aus innerer, teils unbewußter Not – anderen zusetzen und dann unter ihrer Antwort leiden. Und dann folgt das, was wir kennen: Ein jahrelanger Prozess der Abarbeitung mit Fortschritten und Rückfällen, in dem die richtige Diagnose ein hilfreicher, kritischer Begleiter und Kompass sein kann.
Sie ist dabei nur ein hoffnungsvoller Anfang, denn auch Therapeut und Therapie müssen zu einem passen.
Die innere seelische Arbeit und die erforderliche Geduld verbleiben uns selbst als unsere ureigentliche Aufgabe, die keine Diagnostik und keine Therapie uns abnehmen können, denn das sind nur gute und notwendige Hilfsmittel auf unserem Weg, das Leben besser zu bestehen.