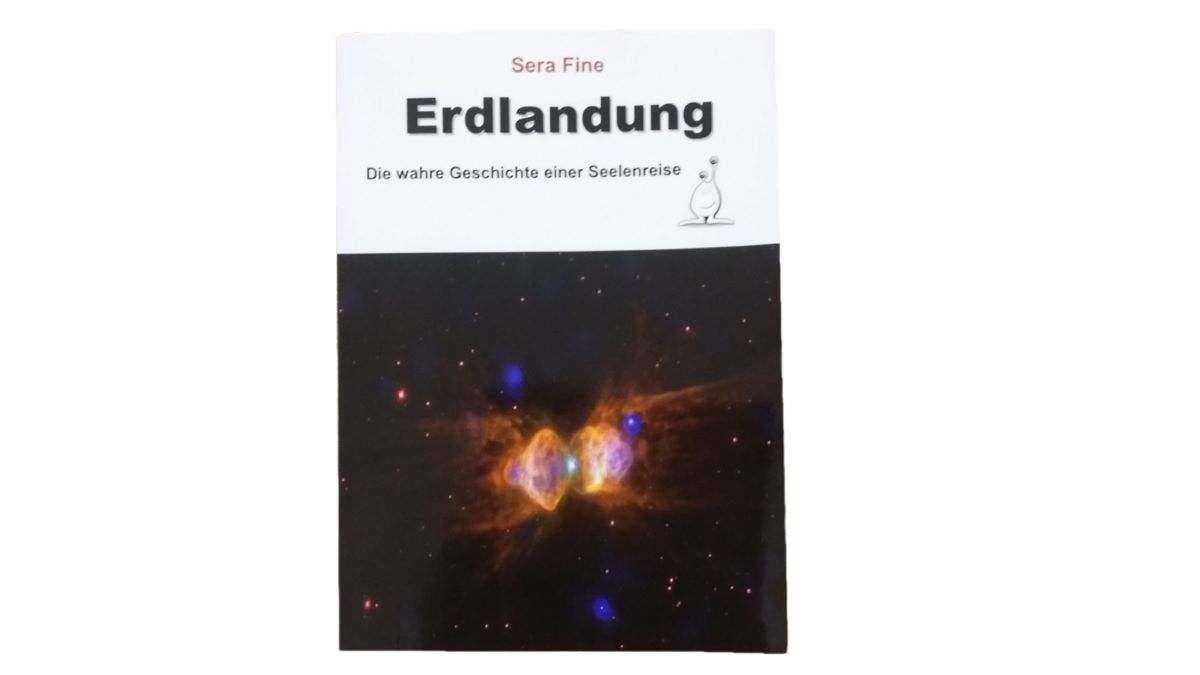Von der Rückseite des Buches:
L587 berichtet seiner Einsatzzentrale vom Zustand des Planeten Erde, während er ein irdisches Wesen (mich) durch dessen dunkelste Zeiten begleitet. Zum Beispiel, auf welche Schwierigkeiten die gegenpolaren männlichen und weiblichen Wesen stoßen bei ihren Versuchen, genug Geldmittel zu erwerben und sie sich nicht gleich wieder aus der Tasche ziehen zu lassen. Wie dunkel-magische Substanzen Erleichterung schaffen sollen, aber alles nur schlimmer machen. L587 ist angestrengend, schlaumeierisch, aber voller guter Absichten. Und fest entschlossen, S307, der über sein Wirken wacht und einen detaillierten Bericht einfordert, nicht zu enttäuschen. Auch, wenn das ihm schutzbefohlene Erdwesen in Seelennöte gerät, aus die es kaum wieder herauszufinden scheintt. Nicht zuletzt auch wegen ihm. Mit L587 kommt ein Wesen zu Wort, das in der Psychiatrie unerwünscht ist, obwohl es doch die Rettung des Planeten aus dem Würgegriff der schwarzen Schlange und die Befreiung aller versklavten Wesen plant.
Über die Autorin:
Sera Fine ist das Pseudonym einer 1969 geborenen Künstlerin, die mit Rücksicht auf ihre Familie und einigen Personen, die in „Erdlandung“ kritisch beschrieben werden, anonym bleiben möchte. Nach einem Berufseinstieg als Fremdsprachensekretärin in einer Maschinenbaufirma und anschließender Tätigkeit im Auswärtigen Dienst, nahm S. ein Studium der Anglistik und Germanistik auf. Welches dann, nach Auftreten einer ersten schweren Krise, der weitere folgen sollten, abgebrochen wurde. „Erdlandung“ ist die wahre Geschichte ihres Ringens um ein erweitertes Verständnis für die seelischen Phänomene, die ihr Leben prägen und ein Zurückfinden in die Normalität, in der dieses Verständnis schließlich Platz finden soll. Geschildert wird der innere Prozess eines seelischen Ausnahmezustandes, wie auch der gesellschaftliche und schließlich globale Zusammenhang, in dem er steht, und zwar aus Sicht des fiktiven Aliens L587. Derzeit unterstützt S. Initiativen anderer Engagierter, die sich zum Beispiel für die Einrichtung von Frauen- und Männerstationen in psychiatrischen Kliniken einsetzen.
ΙΗ Behandler
Während das Stationspersonal fleißig über S. berichtet und dokumentiert, beobachtet S. mit jedem weiteren Klinikaufenthalt immer genauer diese Lebenseinheiten, die sie behandeln, bewerten und reglementieren dürfen. Ihre Verunsicherung ist groß und das Erkennen der Spielregeln, die ein Zurechtfinden in so einem Umfeld ermöglichen, sehr wichtig. Es gilt, möglichst schnell herauszufinden, welcher Behandler Hilfe leisten wird, wenn S. darum bittet, und welcher Behandler genervt, vielleicht sogar beleidigend reagieren wird. Behandler, die sich zum Beispiel ewig Zeit lassen werden, bis das Badezimmer für ihr Morgenbad aufgeschlossen wird.
Während man da in seinem Bademantel allen im Weg zu stehen scheint.
- hat nun einmal eine dünne Haut und versucht zu vermeiden, sich kaltschnäuzige Antworten einzufangen. Das ist aber nicht immer einfach. Die eine Pflegerin bietet einen Badezusatz an, mit Eukalyptusduft: „Der wird ihnen sicher guttun, genießen sie ihr Bad mal richtig schön“. S. nimmt den gerne an. Eine andere Pflegerin in der Schicht einige Tage später, wird, auf den Badezusatz angesprochen, S. erklären:
„Wir sind hier kein Hotel, und Badezusätze gibt es nicht“.
Mit den Pflegewesen hat der Realitätsflüchtige am meisten zu tun, sie begleiten und leiten häufig auch die Morgenrunden. Angenehm ist das Kumpelwesen, das mit Realitätsflüchtigen redet wie mit Freunden und viel aus seinem Privatleben erzählt. Man muss keine Angst vor ihm haben. Sollte aber nicht zu überrascht sein, wenn ihm Anvertrautes in Besprechungsrunden und schließlich in der Krankenakte landet.
Dann gibt es das Pflege-VIP, das sich wie ein Star unter Bewunderern bewegt. Man darf es nicht einfach so für irgendwelche profane Gefälligkeiten heranzuziehen versuchen. Es wird sich sicher nicht dazu hergeben, das Erbrochene einer Zimmernachbarin zu beseitigen. Wie es wortlos, mit hochgezogenen Augenbrauen zu verstehen gibt. Es ist unnahbar, greift aber auch nicht unvermittelt an.
Anders als das humorlose, sehr zackige Pflegewesen. Mit dem kann man nur auskommen, wenn man bereit ist, sich an seinen oder ihren Kasernenhofton zu gewöhnen. Immerhin fühlt es sich zuständig, jeden Missstand auf Station sofort zu beseitigen, oder zumindest beseitigen zu lassen. Wenn auch nicht ohne harsche Ansprache, falls für den Missstand ein Schuldiger auszumachen ist. Einige dieser militärisch auftretenden Wesen erlebt S. als um einiges aggressiver als die vermeintlich gefährlichen Wesen, die sie betreuen.
Das hochgradig aggressive Pflegewesen scheint ständig kämpfen zu wollen, und zwar besonders gerne mit einem Wesen wie S. Das Provokationen sehr kränkt, sich aber nicht so schnell zu wehren traut. Ein schnippischer Kommentar kann aber manchmal nicht zurückgehalten werden. Was zwar nicht gleich drakonische Maßnahmen nach sich zieht, aber bedeutet, dass man dieses Pflegewesen jetzt wie einen Schatten an sich kleben hat. Man denkt an nichts Böses, während man den Gang zum Aufenthaltsraum entlangschlendert, und da kommt es aus dem Nichts geschnellt und bellt los.
Es ist wie bei diesen Spaziergängen in den kleinen Gärten an ihrer Wohnung, wo sie gerne, den schönen Sommertag genießend, die schmalen Wege entlangspaziert.
Und nicht selten plötzlich direkt neben ihr eine wütende Dogge 34 loskläfft. Nur, dass es hier keine Hecke mit Zaun gibt. Dauernd scheint dieses Wesen ihr sagen zu wollen: „Du bist hier gar nichts, kapiert!“ S. hat auch Vorgesetzte gehabt, die sich ähnlich verhielten. Sie registriert, das Pflegewesen unter Realitätsflüchtigen kann sich das Gebaren eines cholerischen Konzernchefs erlauben.
Kommt ein ebenfalls hochgradiger aggressiver, männlicher Neuzugang, ist dieses Pflegewesen oft nicht zu sehen. Nur wenige legen es darauf an, einen noch nicht mit klinischer Substanz beruhigten Neuzugang zu provozieren. Aber einige tun es tatsächlich. Wenn der Neuzugang dann angemessen reagiert, droht ihm gleich zu Anfang seines Aufenthaltes eine Fixierung. Was bedeutet, dass er auf ein Bett gebunden wird und eine klinische Substanz injiziert bekommt.
Dies weiß S. allerdings nur vom Hörensagen. Da ist am Abend zuvor ein neuer Patient auf Station gekommen, es hat einigen Lärm gegeben, und jetzt ist er verschwunden in einem Zimmer, das niemand betreten darf. S. hat während der mehreren mehrmonatigen Aufenthalte in dem Behandlungszentrum nie mit eigenen Augen gesehen, dass ein Patient einen Behandler angegriffen hätte, auch nicht auf der geschlossenen Station. Wüste Beschimpfungen und auch Beleidigungen, vor allem weiblicher Pflegewesen, gab es öfter. Bedrohungen oder Tätlichkeiten nur unter Patienten. Wenn zum Beispiel mehrere verängstigte, misstrauische Wesen sich ein Zimmer teilen müssen, wie es die Regel ist, oder aber alle dünnhäutigen Wesen gleichzeitig zusammentreffen im kleinen Speiseraum, um dort dicht gedrängt die Mahlzeiten einzunehmen. Ein Rückzug aufs Zimmer nicht erlaubt ist, auch nicht mit nur einem belegten Brötchen. Und so kommt es schon mal zu Streit, wirft zum Beispiel eine Patientin mit Essen um sich, weil sie Abstand braucht.
Das aggressive Pflegewesen hat zu diesem Zeitpunkt den Speiseraum für seine Raucherpause verlassen. Vorher aber war es zu Höchstform aufgelaufen, als es darüber zu wachen galt, dass kein Patient vorzeitig diesen Raum betritt. Dort ist nämlich um 12:00 Uhr Einlass zum Mittagessen, und keine Minute früher, nicht etwa um 11:57 Uhr, kann man sich doch merken, oder, und hat man schon mal die Uhr gesehen, die da groß und breit an der Wand hängt? S. hat nur einmal versucht, etwas früher in den Speiseraum zu gelangen, und niemals wieder. Jetzt wartet sie brav mit der übrigen hungrigen Meute vor der Glastür und wundert sich über diesen Realitätsflüchtigen, der es Tag für Tag erneut versucht, etwas früher hineinzurutschen. Was ihm niemals gelingen wird und ihm jedes mal eine kalte Dusche beschert.
Diese Meute zu verpflegen, ihr Essen vorzubereiten, ist diesem Pflegewesen wohl im Grunde zutiefst zuwider. Am liebsten würde man die Tür niemals öffnen. Aber es geht nicht anders, irgendwann muss die Unterwelt in den Speiseraum gelassen werden. Jetzt kann ein gemütliches Beisammensein noch ein bisschen gestört werden, mit Kommentaren wie: „Für Euch könnte man auch eine Dose aufmachen.“ Bevor man dann eben in die verdiente Pause verschwindet und einen unorganisierten Haufen zusehen lässt, wie er klarkommt.
Die Ärzte trifft man an einem Vormittag in der Woche, an dem die Realitätsflüchtigen nacheinander zur Sprechstunde zu erscheinen haben. Die Unterredung dauert dann selten länger als 15 Minuten, und das reicht S. auch. Es gibt noch ein oder zwei persönliche Gespräche in der Woche mit dem zuständigen Medizinkundigen, die länger dauern und anstrengend sind. Diese Behandler haben selten so ein aufgeladenes, forsches Auftreten, wirken in der Regel gelassener. Haben aber auch eigentlich nur eine Mission: Den Realitätsflüchtigen von der Notwendigkeit der Einnahme der für ihn vorgesehenen klinischen Substanz zu überzeugen und die Dosis festzulegen.
Diese Dosis scheint grundsätzlich etwas höher zu liegen, als der Realitätsflüchtige freiwillig zu nehmen bereit ist. Sie wird in der Krankenakte dokumentiert, und das Pflegewesen muss dann durchsetzen, dass die Substanz vom Realitätsflüchtigen genommen wird. Oder sie ihm auch injizieren. Ob nötig oder nicht, geht dem Pfleger oder der Pflegerin dabei nichts an. Das ist sicher die undankbarere Aufgabe. Es gibt Regelwerke zur Organisation so einer Station, denen man zum Beispiel entnehmen kann, wann eine Zwangsbehandlung gerechtfertigt ist. Wozu auch der Zwang zur Einnahme oder Injektion der klinischen Substanz gehört. Der eigentlich fast nie sein
darf, aber fast immer angedroht wird, wenn ein Realitätsflüchtiger die Einnahme oder Injektion nicht sofort akzeptiert. Eine hartnäckige Weigerung bringt das Pflegewesen in eine Stresssituation. Es muss den ihm vorgesetzten Medizinkundigen nachweisen, dass den ärztlichen Anordnungen Folge geleistet wurde.
Ärzte müssen also in der Regel nicht so drohend auftreten, verstehen es aber auch, auf subtile Art und Weise, mit spöttischem Grinsen und kleinen Sticheleien, S. zu ärgern. Wenn sie denn dieses Arztwesen sind, das bestimmte Patienten, oder eben Patientinnen, gerne etwas provoziert. S. versteht, man darf das, und sie nicht.
Sie kann sich sehr aufregen, wenn sie sich unfair behandelt fühlt, und musste erfahren, man kann dann sehr schnell ein Mittel namens Tavor verordnet bekommen. Das beruhigen soll, aber leider auch süchtig macht.
- kennt inzwischen mehrere tavorabhängige Wesen, die diese Droge jahrelang verschrieben bekommen haben. Und dann, nachdem sie überzeugt waren, ohne dieses Mittel nicht mehr leben zu können, es plötzlich absetzen sollten. Da nun auf einmal überrascht festgestellt wurde, dass das Wesen eine Sucht entwickelt hatte.
Womit sich dann auch ein neues Behandlungsfeld ergeben hat. Zweimal hat S. miterlebt, wie ein verzweifeltes Wesen durch Selbstmorddrohungen versuchte, die Droge, die ihm ja immerhin einmal als Medikament verordnet wurde, wieder einzufordern, aber ohne Erfolg. S. fürchtet dieses Mittel deshalb sehr. Es war ein Fehler, es die Behandler wissen zu lassen.
Klinikbehandler müssen heute vor allem motiviert sein, ein anderes Wesen zu etwas zu bringen, was es nicht will. Denn sehr häufig will es die klinische Substanz nicht, oder zumindest nicht in sehr hoher Dosis. Die Kombination männlicher Behandler und weibliche Behandelte ist deshalb die energetischste bei diesem immer wieder gleichen Spiel. Das mit einer scheinbaren Erkundigung beginnt und immer damit endet, dass mehr klinische Substanz verordnet wird.
Das Eingeständnis einer gedrückten Gemütslage ist dabei die direkte Einladung zur Erhöhung der Medikation. Bei sichtlicher Genugtuung der Behandler, so leicht ein Leidbekunden abdeckeln zu können, und ebenso sichtlicher Enttäuschung des Behandelten. Der sich nach der eingangs warm und besorgt gestellten Frage nach seinem Befinden Hoffnung auf weitergehendes Interesse und echtes Mitgefühl gemacht hatte. Ablehnung der Erhöhung von Substanz stellt dann sein Leidempfinden in Frage. „Aber Sie sagten doch, es geht Ihnen schlecht? Möchten Sie denn nicht, dass es Ihnen besser geht?“ Wer den Drang, sein Leidempfinden mitzuteilen, nicht beherrschen lernt, tappt immer wieder in diese Falle.
Möglichst wenig sagen, auf keinen Fall eine schwierige Gemütslage eingestehen, und sich nicht aufregen. Das scheint die einzige Strategie zu sein, unbeschadet durch ein Gespräch mit dem zuständigen Medizinkundigen zu kommen. Dem man nicht ausweichen kann. Der S. Gegenstrategie schon kennt und in dem Gespräch heute auf Fragen nach dem Befinden verzichtet. Aber natürlich schon einen neuen Plan vorbereitet hat, um S. einzuzingeln.
„Frau R., wir haben Sie schon den ganzen Tag gesucht, wo waren Sie denn?“
„Ich war in meiner Wohnung.“ (Die haben mich gesucht? Oh Schreck. Hoffentlich verbieten die mir jetzt nicht, die Station zu verlassen.)
„Und was haben Sie da gemacht?“
(Geht Sie nichts an.) „Gar nichts, nur auf dem Bett gelegen.“
„Nehmen Sie eigentlich an den Therapien auf Station teil?“
(Fast gar nicht. Keine Lust. Muss man das?) „Ja“.
„Welche?“
„Bewegungstherapie, manchmal.“
„Wann?“
„Gestern.“ (Stimmt sogar.)
„Und davor?“
„Ein, zwei Mal war ich da.“ (In den letzten sechs Wochen. Wissen Sie ja sowieso.)
„Und die Ergotherapie?“
„Ist ausgefallen.“ (Schade sogar, ich mag die Frau M.)
„Ausgefallen? Die ganze Woche?“
„Nein, aber gestern.“ (Jetzt muss ich da wohl immer hin. Naja, da spielen und da basteln wir, ist nicht so schlecht da.)
„Frau R., es ist wichtig, dass Sie sich mehr einbringen. Ich glaube, dass Sie mehr Medikamente brauchen.“
(Überraschung. Hatte schon gedacht, er vergisst das heute.) „Möchte ich aber nicht.“
„Ich habe das aber bereits mit dem Oberarzt besprochen, und der sieht das genauso.“
(Blöder Kerl, interessiert mich nicht, schluck’ den Kram doch selber.) „Ich möchte nicht mehr Medikamente nehmen.“
„Warum nicht?“
„Mir geht es gut.“ (Im Prinzip, nur jetzt gerade nicht, wo ich hier sitze, schlechte Schwingung.)
„Frau R., wir müssen uns noch mal mit dem Oberarzt zusammensetzen und über die Medikamente sprechen. Am besten gleich morgen.
„Meinetwegen.“ (Morgen bin ich wieder in meiner Wohnung.)
Man findet S. später in der Ergotherapie, wo man sie dann herausholt, sodass es zu dem Gespräch dann doch kommt.
Die weiblichen Wesen, die Pflegerinnen wie Ärztinnen, sind mit ihren Eigenarten nicht so deutlich ausgeprägt erkennbar wie die männlichen Behandler. Es handelt sich bei ihnen meistens ebenfalls um sehr zackige, ordnungsbesessene Wesen.
Wobei die Ärztinnen etwas distanzierter sind als die Pflegerinnen. Es gibt das weibliche Kumpelwesen aber auch, S. mag es sehr, und es gibt auch die freundlichen, einfühlsamen Behandlerinnen. Aber nicht sehr viele, und mit der Zeit immer weniger.
- vermutet, dass deren Überlebenschance auf so einer Station wohl eher gering ist.
- erinnert sich an eine angenehme Person mit sanfter Ausstrahlung, die ihr sehr gut getan hat. Die allerdings oft traurig am Fenster des Aufenthaltsraums stand und sich nach draußen zu sehnen schien. Ob sie sich an ihrem Arbeitsplatz nicht wohl fühlte, kann S. so genau nicht wissen, aber sie vermutet es. Und sie vermutet auch, dass es eher an den zackigen Kollegen, als an den schlurigen Realitätsflüchtigen lag.
Der Ton auf Station ist also häufig nicht angenehm. Patienten zu ignorieren oder unfreundlich abzufertigen wohl manchmal der einzige Weg, nicht überrannt zu werden von dieser großen Menge Wesen mit unterschiedlichsten Hilfewünschen und – forderungen. Sich aufzuregen über eine schlechte Behandlung ist dann auch ziemlich sinnlos und bewirkt genau das Gegenteil des Erwünschten. Behandler, die sich etwas Zeit für ein paar persönliche, nette Worte nehmen und den Realitätsflüchtigen helfen, sich ein bisschen wohler zu fühlen sind für S. sehr wichtig. Man kann diese Zuwendung aber nicht einfordern. Wenn man sie bekommt, ist es ein Geschenk.
Therapeuten, die zum Beispiel Musik, Kunst- oder Bewegungstherapie anbieten, erlebt S. oft als angenehme Wesen.
Insgesamt können diese Behandlungszentren nicht als ein Raum frei von Konflikten beschrieben werden. Das Leben mit all seinen unterschiedlichen Facetten, den angenehmen und schwierigen Begegnungen, spielt sich auch hier ab. Eher sogar noch intensiver, und man kann nicht ausweichen. Gut, man ist nicht allein, und beruhigende, dämpfende Mittel sind ausreichend vorhanden. Aber niemand kann dem seelisch Verletzen einen sicheren Schutzraum garantieren. Weshalb S. irgendwann beschließt, diesen Schutzraum selber zu erschaffen.
Dafür schafft sie einen Raum in ihrem Inneren, den sie sich frei von Gefahren vorstellt, in dem sie völlige Akzeptanz erfährt. Dort kann sie Kraftwesen wie mir begegnen. Sie kann alles mitteilen, was zu ihr und ihrem Leben gehört, ohne dass eine Bewertung erfolgt. Wahre Kraftwesen interessieren sich nicht für Schuldzuweisung, während sie ein Auffinden von Lösungen aus schwierigen Lebenslagen unterstützen.
- stellt fest, Kraftwesen wollen sie zu nichts verleiten und von nichts überzeugen.
Sie sind einfach nur da, beleuchten, machen verständlich. Manche Erdwesen würden den Austausch mit einer solchen Kraft als Gebet bezeichnen. Oder die bewertungsfreie Betrachtung innerer Vorgänge Meditation nennen.
- wird mit der Zeit erkennen, dass Wesen, die ihr Vorwürfe machen oder sie unter Druck setzen, keine Kraftwesen sein können. Ihre Unterscheidungsfähigkeit und ihre innere Unabhängigkeit nehmen zu, langsam. Aber wir sind nicht in Eile. Es ist nicht schlimm, dass es noch etwas dauern wird, bis S. das, was so langsam in ihr Herz fließt, bewusst wahrnehmen und auch zum Wohle anderer einbringen kann.
Erdlandung – Die wahre Geschichte einer Seelenreise
von Sera Fine
Herstellug und Verlag:
Books on Demand, Norderstedt | www.bod.de
ISBN: 978-3-7412-5007-1
9,90 € zzgl. Versand